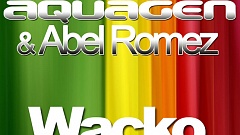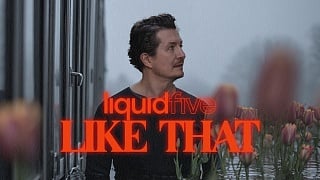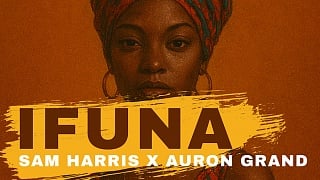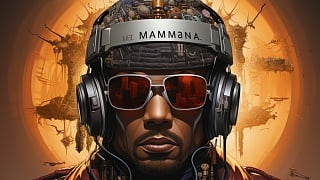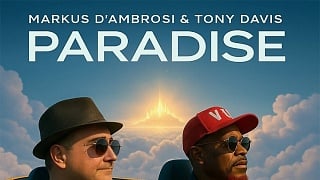Life in Plastic, It's Fantastic
Die Geschichte hinter dem Song: 'Aqua - Barbie Girl'
 Come on Barbie, Let's Go Lawsuit!.
Come on Barbie, Let's Go Lawsuit!.
Wenn man das Jahr 1997 in Flaschen abfüllen könnte, würde es wahrscheinlich nach billigem Haarspray, süßem Alkopop und dem unverkennbaren, quietschfidelen Synthesizer-Riff von „Barbie Girl“ riechen. Für eine kurze, aber intensive Zeitspanne gab es kein Entkommen. Dieser Song war kein normaler Hit; er war eine globale Besessenheit, ein kulturelles Phänomen in schrillem Pink, das sich wie Kaugummi in den Gehörgängen der Welt festsetzte.
Bubblegum Pop
Oberflächlich betrachtet war „Barbie Girl“ der Inbegriff des „Bubblegum Pop“ - eine dänisch-norwegische Band namens Aqua, gekleidet in absurd-futuristische Kostüme, die einen albernen Dialog zwischen zwei Puppen führten. Doch unter dieser glänzenden Plastikoberfläche lauerte eine Bombe. Dieser Song war eine satirische Granate, ein trojanisches Pferd aus Eurodance, das so provokant war, dass es einen der größten Spielzeugkonzerne der Welt in einen jahrelangen, erbitterten Rechtsstreit zwang.
Mehr als 25 Jahre später ist der Song unsterblich. Er überlebte den Prozess, wurde zum Meme und erlebte 2023 eine triumphale Wiedergeburt als treibende Kraft hinter dem Soundtrack des Barbie-Kinofilms. Die Geschichte von „Barbie Girl“ ist die bizarre Chronik darüber, wie eine dänische Kunstausstellung zu einem anzüglichen Witz, einem Welthit und schließlich zu einem der berühmtesten Rechtsfälle der Popkultur wurde - mit einem der amüsantesten Urteile, das je gefällt wurde.
Die Kitsch-Inspiration: „Life in Plastic, It's Fantastic“
Die Geschichte von Aqua beginnt nicht auf einer Bühne, sondern in Kopenhagen. Die Gruppe bestand aus den Sängern Lene Nystrøm (die Norwegerin) und René Dif (der Däne) sowie den dänischen Keyboardern und Produzenten Søren Rasted und Claus Norreen. Nach einem Fehlstart unter dem Namen „Joyspeed“ benannten sie sich in Aqua um und landeten 1996 in Dänemark mit „Roses Are Red“ einen Hit. Sie hatten ihren Sound gefunden: eine grelle, cartoonhafte Mischung aus Eurodance und Pop.
Die zündende Idee für ihren größten Hit kam Søren Rasted, als er eine Kunstausstellung über Kitsch-Kultur in Kopenhagen besuchte. Ein Werk fesselte seine Aufmerksamkeit: eine Kugel, die komplett aus Barbie-Puppen gefertigt war. Angesichts dieses Anblicks schoss ihm der Satz durch den Kopf, der bald zum Welthit werden sollte: „Life in plastic, it's fantastic“ (Leben in Plastik, es ist fantastisch).
Zurück im Studio wurde diese Zeile zur Grundlage für einen Song. Die Bandmitglieder Rasted und Norreen produzierten den Track zusammen mit den Produzenten Johnny Jam und Delgado und schufen den perfekten musikalischen Rahmen. Die Struktur war genial einfach: Lene Nystrøm schlüpfte in die Rolle der Barbie und sang mit einer übertrieben hohen, piepsigen Puppenstimme. René Dif übernahm den Part des Ken mit einer tiefen, fast schon lüsternen Stimme.
Die süße Provokation: „Undress Me Everywhere“
Was den Song von einem bloßen Kinderlied unterschied und ihn zur Satire machte, war der Text. „Barbie Girl“ war von Anfang an als augenzwinkernder, sozialer Kommentar gedacht - eine Parodie auf die hyper-perfekte, aber seelenlose Welt der Puppe. Der Song war explizit nicht für Kinder gedacht, auch wenn der Name dies vermuten ließ.
Die Zweideutigkeiten waren alles andere als subtil. Lene (als Barbie) bezeichnete sich selbst als „Bimbo“ - ein abfälliger Begriff für eine attraktive, aber dumme Frau. René (als Ken) befahl ihr: „Come on Barbie, let's go party!“ Die berüchtigtste Zeile war Barbies Einladung: „You can brush my hair, undress me everywhere“ (Du kannst mein Haar bürsten, mich überall ausziehen). Weitere Sätze wie „You can touch, you can play“ (Du kannst berühren, du kannst spielen) ließen wenig Raum für Interpretationen.
Für Aqua war dies ein klares „F*CK YOU“ an die gesellschaftlichen Normen, die Barbie repräsentierte - die Reduzierung der Frau auf ihr Äußeres. Sie hielten der Welt einen Spiegel vor, der zeigte, wie absurd dieses Idealbild war. Die Welt tanzte begeistert mit, machte den Song 1997 zu einem globalen Phänomen und katapultierte ihn in Dutzenden von Ländern an die Spitze der Charts. Allein im Vereinigten Königreich verkaufte sich die Single im ersten Jahr 1,59 Millionen Mal und gehört dort zu den meistverkauften Singles aller Zeiten.
Der Rechtsstreit: Mattel vs. Aqua
Während die Welt tanzte, schäumte man in der Zentrale von Mattel vor Wut. Der Spielzeugriese sah den Ruf seiner wertvollsten Marke beschädigt und reagierte prompt. Noch im selben Jahr, 1997, reichte Mattel eine Klage gegen Aquas Plattenfirma MCA Records ein.
Der Vorwurf: Der Song habe die Barbie-Puppe sexualisiert, das Image der Marke beschädigt und durch die Verwendung des Wortes „Bimbo“ eine Assoziation mit Dummheit geschaffen. Mattel warf der Band vor, die Marke Barbie zu beschmutzen. Die Forderungen waren drastisch: ein sofortiger Verkaufsstopp und die Vernichtung aller existierenden Kopien des Songs.
Die Plattenfirma MCA Records ließ sich nicht einschüchtern und ging zum Gegenangriff über. Ihre Verteidigung war einfach: Der Song sei eine Parodie und damit durch das Recht auf freie Meinungsäußerung (den Ersten Verfassungszusatz der USA) geschützt.
Das Urteil: „The Parties Are Advised to Chill“
Der Rechtsstreit zog sich über Jahre hin. Gerichte auf niedrigeren Instanzen wiesen Mattels Klagen immer wieder ab, doch der Konzern legte jedes Mal Berufung ein. Der Fall landete schließlich vor dem Neunten Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten.
Im Jahr 2002, fünf Jahre nach Veröffentlichung des Songs, fällte der Richter Alex Kozinski das endgültige Urteil. Er wies die Klage von Mattel ab und bestätigte, dass „Barbie Girl“ eine Parodie sei und als solche geschützt ist.
Doch Richter Kozinski beließ es nicht dabei. Er beendete seine Urteilsbegründung mit einem Satz, der in die Annalen der Popkultur-Justiz einging: „The parties are advised to chill.“ (Den Parteien wird geraten, sich abzukühlen.) Es war der perfekte, humorvolle Schlussstrich unter einen absurden Kampf zwischen einem Plastik-Giganten und einer Bubblegum-Pop-Band.
Das Vermächtnis: Vom Feind zum Hit-Lieferanten
Die Geschichte von „Barbie Girl“ endet jedoch nicht mit dem Gerichtsurteil. In einer erstaunlichen Wendung der Ironie vollzog Mattel Jahre später eine komplette Kehrtwende. Nachdem der Konzern den Song juristisch nicht stoppen konnte, beschloss er, ihn zu umarmen. Im Jahr 2009 lizenzierte Mattel die Melodie von „Barbie Girl“ für eine eigene Werbekampagne. Der Haken: Sie schrieben den Text komplett um und ersetzten die provokanten Zeilen durch familienfreundliche Slogans wie „You can be a star / No matter who you are“ (Du kannst ein Star sein / Egal, wer du bist).
Die ultimative Versöhnung kam 2023 mit dem Blockbuster-Film Barbie. Obwohl der Originalsong selbst nicht im Film vorkam - Lene Nystrøm merkte an, das wäre wohl zu „auf der Nase“ (on the nose) gewesen - war es die Hauptdarstellerin Margot Robbie, die darauf bestand, dass der Film dem Song Tribut zollen müsse.
Die Lösung war ein Geniestreich: Der Soundtrack enthielt den Hit „Barbie World“ von Nicki Minaj und Ice Spice, der „Barbie Girl“ massiv sampelt. Für Nicki Minaj, die ihre Fangemeinde seit Jahren „Barbz“ nennt, war dies ein „Moment, in dem sich der Kreis schließt“. Plötzlich war Aqua, einst der Staatsfeind Nummer 1 von Mattel, offiziell als Künstler auf dem Soundtrack des Films gelistet und ein integraler Bestandteil des größten Marketing-Coups des Jahres.
„Barbie Girl“ hat bewiesen, dass es weit mehr ist als nur ein One-Hit-Wonder. Es ist ein Meisterwerk der Pop-Satire, das den Spagat zwischen Dummheit und Genialität perfekt meisterte und von einem Kopenhagener Kunstraum bis in den Obersten Gerichtshof und zurück in die Kinosäle von Hollywood reiste. Das Leben in Plastik ist eben doch fantastisch - und unglaublich langlebig.
Hier hast du die Möglichkeit den Song zu bewerten. Einfach die gelben Sterne auf der rechten Seite anklicken. Die Gesamtwertung ist ein Mittelwert aller abgegebenen Stimmen.
Sei der Erste, der hier einen Kommentar schreibt.






![15 Years Aqualoop Rec. » [Tracklist] 15 Years Aqualoop Rec.](/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Fimages%2FDezember_2015%2F15-Years-Aqualoop-Rec.jpg&w=240&h=135&zc=1)