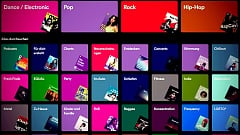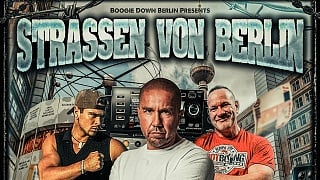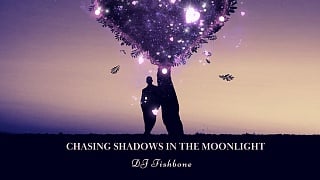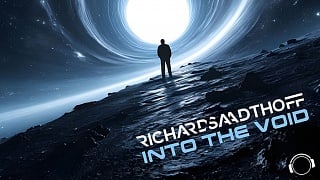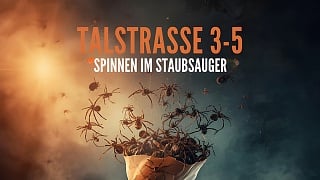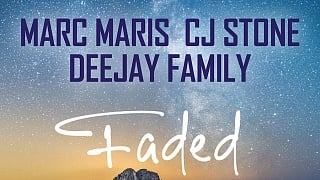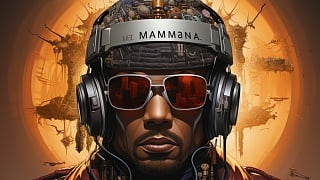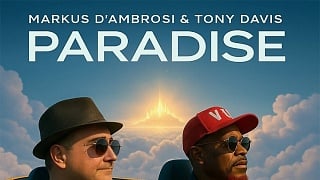Schwere Vorwürfe gegen den Streamingdienst
Lässt Spotify gezielt Charthits plagiieren?
 Lässt Spotify gezielt Charthits plagiieren?
Lässt Spotify gezielt Charthits plagiieren?
Fast schon traditionell sieht sich der schwedische Streaminganbieter Spotify ebenso zahlreichen wie vielfältigen Vorwürfen ausgesetzt. Musiker von Herbert Grönemeyer bis Taylor Swift fühlten sich ungerecht behandelt und verständlicherweise auch unterbezahlt durch den Musikdienst, Datenschützer schlugen häufiger Alarm als ihnen lieb war, Vorwürfe, Musik werde durch die ubiquitäre Verfügbarkeit als Streaming-Angebot entwertet, wurden laut. Vor einigen Jahren gelang es der US-amerikanischen Indie-Band Vulfpeck sogar, den Konzern mit einem völlig stummen Lied zu überlisten, für das den Bandmitgliedern dank der zahlreichen Abrufe ihrer großen Fanbase offenbar 20.000 US-Dollar an Vergütungen ausbezahlt wurden, ehe die Kuratoren von Spotify die Täuschung bemerkten und sanktionierten. Das nun kursierende Gerücht ist allerdings weitaus prekärer: Der Branchenspezialist Adam K. Raymond wirft dem Branchenprimus vor, Musikproduzenten dafür zu bezahlen, aktuelle Charthits zu plagiieren, um Honorarzahlungen an die Original-Künstler zu umgehen.
Schwere Vorwürfe
Jüngst erhob der New-York-Magazine-Autor Adam K. Raymond den Vorwurf, Spotify fördere sogenannte „Coverbots“. Dabei handelt es sich um unbekannte Produzenten, die eine annähernd akkurate Version eines Charthits produzieren und anschließend im Onlinehandel zur Verfügung stellen. Zuletzt wurde der Rapper Kendrick Lamar Opfer eines solchen Plagiats. Mit knapp 300 Millionen Abrufen auf Spotify hielt sich sein Song „Humble“ mehrere Wochen lang in den Top 3 der Billboard Streaming Charts. Zugleich existiert auf Spotify allerdings auch eine qualitativ minderwertige Coverversion des Songs von einem ominösen „King Stitch“, die unter dem Titel „Sing Down And Be Humble“ immerhin ganze 300.000 Abrufe verzeichnen konnte. Die Intention dahinter ist klar: Kaum ein „Mainstream-Hörer“ kennt sich wirklich mit der Musik, die er hört, aus.
Die Wenigsten merken sich tatsächlich die Titel von Liedern, die sie im Radio hören. Vielmehr tippen sie den Beginn des Refrains in die Suchleiste ein, in der Hoffnung, der Spotify-Algorithmus werde schon das richtige Lied für sie finden. Damit ist es ein Leichtes für die Fälscher, die Suchergebnisse durch geschickte Benennung und entsprechend gestaltete Coverbilder so zu manipulieren, dass die Hörer zunächst auf die billigen Replikate geleitet werden und im schlimmsten Falle auch dort bleiben. Man sollte meinen, dass ein solcher Irrtum rasch bemerkt werden würde, doch hier greift wiederum die oben angesprochene Entwertung der Musik durch Spotify ein.
Tatsache ist: Musik ist bei Spotify zu einem reinen Konsumprodukt geworden, sie wird also größtenteils gehört, weil sie existiert und sie gerade viele andere Nutzer hören. Genaues Hinhören findet hier kaum statt, solange Melodie und Refrain weitestgehend mit dem übereinstimmen, was der Hörer aus dem Radio und anderen einschlägigen Quellen kennt. Das kann man getrost als gehörigen Faustschlag in die Gesichter der oftmals engagierten Künstler werten. Inzwischen gibt es einen ganzen Industriezweig, der gezielt bekannte Lieder nachahmt, um vom Erfolg der Originale zu zehren. Das ist keinesfalls auf Spotify beschränkt, wie diese unrühmliche Version von David Guettas und Justin Biebers Welthit „2U“ eindrucksvoll belegt.
Jetzt wird man einwenden wollen, dass so ein Vorgehen doch nicht rechtens sein kann. Hierzulande gestaltet sich das allerdings wie folgt: In der weit überwiegenden Zahl der Fälle wird das plagiierte Lied bei der deutschen Musikverwertungsgesellschaft GEMA registriert sein, wodurch sich der Künstler vertraglich verpflichtet, der Gesellschaft die Rechte an „anderen Umgestaltungen“ im Sinne des Urheberrechtsgesetzes zu übertragen, die keine Schöpfungshöhe besitzen, also nur einen geringen oder gar keinen schöpferischen Eigenanteil der Plagiierer enthalten.
Das bedeutet mithin, dass die neue Version nur ebenfalls bei der GEMA als Coverversion lizensiert werden muss und eine Genehmigungspflicht gegenüber den Urhebern selbst entfällt. Auch strafrechtlich wird man wenige Anknüpfungspunkte finden. So scheitert eine Betrugsstrafbarkeit der Plagiierer bereits daran, dass die betroffenen Spotify-Hörer durch das Hören der Fälschung wohl weder eine eigene Vermögensdisposition treffen, noch eine relevante fremde - schließlich wird kein Syndikus jemals begründen können, inwiefern sich Fans in einem rechtlich relevanten Näheverhältnis zu ihren Idolen befinden. Bliebe nur das Namensrecht als Angriffspunkt - schließlich bedienen sich die Plagiierer hier ja an dem guten Ruf und der Bekanntheit des Originals, um selbst Profit daraus zu schlagen.
Ein so gearteter Rechtsstreit könnte tatsächlich spannend werden, schließlich erhielt in einem vergleichbaren Fall schon einmal der weitaus bekanntere Namensinhaber gegenüber anderen den Vorzug. Und selbst wenn es sich letzten Endes als rechtens erweisen sollte: Einen faden Beigeschmack hat diese Geschmack in jedem Falle.
Spotifys Stellungnahme
Was Raymond Spotify vorliegend vorwirft, ist allerdings mindestens „starker Tobak“. Seiner Ansicht nach duldet und fördert Spotify die Fälscher gezielt. Er geht sogar so weit zu sagen, Spotify bezahle Produzenten gezielt für Fake-Profile, auf denen sie dann unter Abtretung aller späteren Honoraransprüche billig produzierte Coverversionen aktueller Hits hochladen. Zuletzt tat Spotify dann alles Nötige, um die Wogen zu glätten und die Vorwürfe zu entkräften. Auf Nachfragen des Billboard-Magazins stellte ein Sprecher des Unternehmens klar:
Wir kreieren und kreierten keine "Fake-Künstler“ und präsentieren sie auch nicht in Spotify-Playlisten. Komplett unwahr, Punkt. Wir zahlen Honorare - für Werk und Vertrieb - für alle Lieder auf Spotify, und für alles, was in unseren Playlisten steht. Uns gehören keine Verwertungsrechte, schließlich sind wir kein Label. Unsere gesamte Musik ist von den Rechteinhabern lizensiert und wir bezahlen sie - wir bezahlen uns nicht selbst. - Spotify
Diese Stellungnahme ist eindeutig und lässt auch relativ wenig Raum für Interpretationen - tatsächlich wird sich gerade der Branchenprimus keinesfalls dem Vorwurf ausgesetzt sehen wollen, seine Lizenzgeber moralisch zumindest fragwürdig um ihren verdienten Lohn zu bringen. Tatsächlich muss man Raymonds Anschuldigung vorhalten, dass auch eine billige Produktion einiges Geld kostet. Im obigen, sehr prominenten Fall von Kendrick Lamars Song hätte sich der Konzern dann lediglich etwa 500 Euro abzüglich des Plagiierer-Honorars gespart.
Angesichts dessen wirken diese Vorwürfe gegen das Unternehmen doch fast etwas weit hergeholt. Klar ist jedoch, dass sich die Fälscher als kleinere Produzenten in einer mehr als ungünstigen Verhandlungsposition gegenüber Spotify befinden und für ihre „Cover-Versionen“ daher sicherlich weniger Verwertungshonorar erhalten dürften als bereits bekannte, internationale Künstler. Dementsprechend könnte sich eine Sparquote des Konzerns in solchen Fällen auf einer ganz anderen Ebene ergeben als von Raymond vorgeworfen - und das nicht einmal beabsichtigt, denn schließlich gilt hier natürlich die Unschuldsvermutung. Demgegenüber hat Raymond immerhin insofern Recht, dass Spotify verdächtig wenig gegen Spammer, Fake-Profile und andere Geißeln des modernen Musikbusiness unternimmt und zumindest auf diese Weise zur Entwertung der Musk beiträgt.
Sei der Erste, der hier einen Kommentar schreibt.
Featured Track